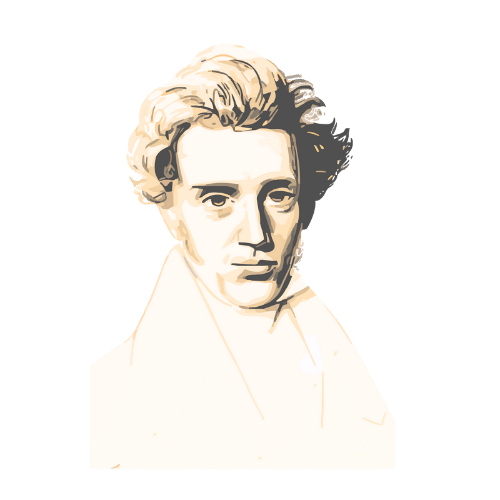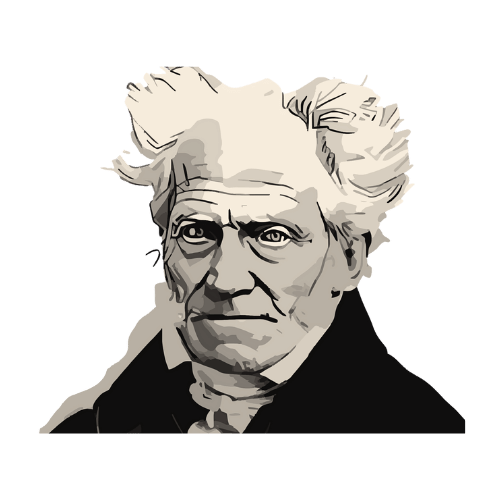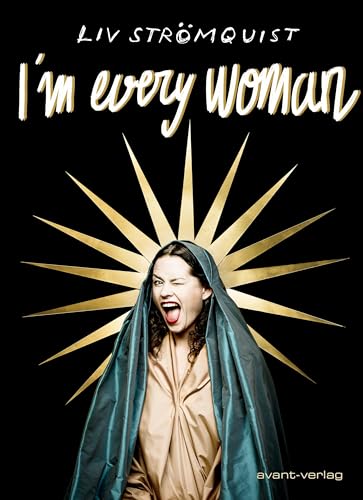Macht Philosophie depressiv? – Über depressive Philosophen
Kann zu viel Philosophie / Philosophieren depressiv machen? Sorgt das Nachdenken über die großen Fragen des Lebens für Schwermut? Sind es die tiefgründigen philosophischen Überlegungen, die zur Depression führen? Der Gedanke ist nicht aus der Luft gegriffen: Es gab einige Philosophen, die depressiv waren und ihr Leiden in ihren Schriften dokumentierten. Die Frage ist: Lassen sich daraus Erkenntnisse über Depressionen ableiten?
Welche Philosophen waren depressiv?
Viel wissen wir nicht. Zumindest die folgenden Philosophen berichteten selbst über ihre Depression:
Søren Kierkegaard: Der „Vater des Existenzialismus“ kämpfte mit tiefen Depressionen und schrieb viel über Verzweiflung und Angst.
Arthur Schopenhauer: Er prägte den philosophischen Pessimismus (vgl. auch depressiver Realismus) und sah das menschliche Dasein als von Leiden gezeichnet, was viele als Ausdruck einer depressiven Grundhaltung interpretieren.
Friedrich Nietzsche: Nietzsche litt unter schweren Krankheiten und Phasen tiefster Niedergeschlagenheit. Seine Philosophie des „Wille zur Macht“ (#Affiliate-Link/Anzeige) stellt einen Versuch dar, seine inneren Kämpfe zu überwinden.
William James: Der amerikanische Philosoph und Psychologe sowie Pionier des Pragmatismus erlebte Phasen schwerer Depressionen, die er in seinen Schriften reflektierte.
John Stuart Mill: Der englische Philosoph und Ökonom durchlebte in jungen Jahren eine schwere persönliche Krise und Depression, die er in seiner Autobiografie (#Affiliate-Link/Anzeige) beschrieb.
Michel Foucault: Der französische Philosoph und Historiker setzte sich intensiv mit Psychiatrie und Geisteskrankheiten auseinander und litt selbst unter akuten Depressionen; in seiner Jugend unternahm er sogar Suizidversuche.
Bertrand Russell: Der britische Mathematiker, Philosoph und Logiker beschrieb ebenfalls Phasen schwerer Depressionen und hatte mit Suizidgedanken zu kämpfen.
Sind alle Denker traurig? (#Affiliate-Link/Anzeige) Fallstudien zum melancholischen Grund des Schöpferischen in Asien und Europa
Was sagt die Philosophie über Depressionen?
Historisch wurde das, was heute als Depression bezeichnet wird, unter verschiedenen Begriffen wie „Melancholie“ oder „Acedia“ diskutiert, die jeweils unterschiedliche Konnotationen trugen (z.B. schizophrene, phobische, psychotische und depressive Zustände).
Während die antike Medizin, insbesondere Hippokrates, die Melancholie primär als ein Ungleichgewicht der Körpersäfte betrachtete, entwickelte sich im Mittelalter mit der Acedia ein Konzept, das eher einen spirituellen Zustand der Lethargie und Gleichgültigkeit beschrieb. Mehr erfahren » Geschichte der Depression
Die Aufklärung wiederum neigte dazu, Melancholie mit Hysterie oder einer Schwäche des Nervensystems gleichzusetzen. Gleichzeitig wurde das Phänomen oft verklärt und idealisiert.
Die Entwicklung der Terminologie (von „Melancholie“ zu „Depression“) spiegelt einen tiefgreifenden Wandel im Verständnis dieser Zustände wider. Es ist nicht lediglich eine sprachliche Verschiebung, sondern eine grundlegende Re-Konzeptionalisierung des Phänomens (wie es in der Antike einst verstanden wurde).
Überblick: Epoche & Depression
1. Epoche
2. Konzept
3. Vertreter
4. „Ursachen“
Antike
(ca. 5. Jh. v. Chr. – 2. Jh. n. Chr.)
Humoral-pathologie
Hippokrates, Galen, Aretaeus, Cicero
Überschuss an schwarzer Galle; psychologische Ursachen (Wut, Furcht, Trauer)
Mittelalter
(ca. 5. Jh. – 15. Jh.)
Spirituelle Sünde (Acedia)
Thomas von Aquin
Abkehr vom Göttlichen, Trauer über spirituelles Gut, Trägheit des Herzens
Renaissance / Frühe Neuzeit
(16. – 17. Jh.)
Umfassende Symptomologie
Robert Burton
Vielfalt von Symptomen, soziale und psychologische Faktoren (Armut, Furcht, Einsamkeit)
Aufklärung
(18. Jh.)
Temperament / Offenheit für das Erhabene
Immanuel Kant
Schwäche des Nervensystems (allgemein); Tiefsinnigkeit, Disposition für das Erhabene (Kant)
19. / 20. Jahrhundert
Existenzielle Bedingung / Sinnlosigkeit
Kierkegaard, Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche, Shestov, Frankl
Missverhältnis im Selbst, Angst vor dem Sein, blinder Wille, Nihilismus, Bodenlosigkeit, Sinnleere
Moderne (20. / 21. Jahrhundert)
Biopsychosoziales Modell
Moderne Psychiatrie, Psychologie
Genetik, Gehirnchemie, psychologische Unterschiede, soziale Erfahrungen, Umwelt
Tabelle – Philosophen und ihre Konzepte der Depression
Antike Philosophie über Depressionen
Platon, Aristoteles, Epiktet, Seneca, Marc Aurel
Das Gleichgewicht der Seelenkräfte
Platon
Platon ist einer der ersten Philosophen, die etwas über psychische Probleme sagten. Im Phaidros (#Affiliate-Link/Anzeige) untersucht er zum Beispiel den "Wahnsinn" in seinen verschiedenen Ausprägungen;
darunter den göttlichen Wahnsinn (Liebeswahnsinn, dichterischer Wahnsinn, prophetischer Wahnsinn), den er als höhere, inspirierte Zustände betrachtet, aber auch den menschlichen Wahnsinn, der als Krankheit verstanden werden kann. Er spricht von einer Störung der Seelenordnung.
Der krankhafte Wahnsinn soll durch körperliche Krankheit oder moralische Verderbtheit verursacht werden.
Ähnlich in seinem Hauptwerk Der Staat (#Affiliate-Link/Anzeige): Hier spricht der platonische Sokrates über die verschiedenen Zustände der Seele (Vernunft, Mut, Begierde) und wie eine Disharmonie oder "Ungerechtigkeit" in der Seele zu innerem Unglück, Leid und einem "kranken" Zustand führen kann, analog zu einem kranken Körper.
Was schlägt Platon vor, um den menschlichen Wahnsinn zu heilen?
Da er Depressionen & Co als Krankheit der Seele begriff, sind seine "Heilungsansätze" eher philosophischer und gesellschaftlicher Natur als medizinisch. Platon empfiehlt bei Geistesstörungen eine korrigierende und pädagogische Herangehensweise, um die seelische Ordnung wiederherzustellen. Bei Verbrechen, die aus solchen Zuständen resultieren, sieht er die Strafe als Mittel der Wahl.
Aristoteles
Seine “Problemata" (Problem XXX, 1) können wohl als wichtigste Quelle der Antike zum Thema Melancholie gelten. Aristoteles (oder sein Schüler Theophrast) fragt, warum "alle, die in Philosophie, Dichtung, Kunst oder Politik herausragend waren, melancholisch zu sein scheinen". Er beschreibt die Melancholie als eine Art Temperament, verursacht durch die "schwarze Galle", die sowohl zu Depressionen und Apathie als auch zu extremen Wahnzuständen und Genie führen kann.
Im Werk "Nikomachische Ethik" (#Affiliate-Link/Anzeige) analysiert er detailliert die Rolle von Emotionen (Affekten) wie Furcht, Zorn, Mitleid, Freude und Schmerz für die menschliche Tugend und das Glück. Ein Ungleichgewicht oder unkontrollierte Leidenschaften werden als hinderlich für ein tugendhaftes und glückliches Leben beschrieben und können zu Leid führen.
Wozu rät Aristoteles, um die Psyche zu behandeln?
Entgegen Platons Dualismus betonte Aristoteles die Einheit von Seele und Körper als untrennbar. Die Seele ist für ihn die Form eines natürlichen Körpers, der das Leben potenziell besitzt. Das bedeutet, dass körperliche Zustände die Seele beeinflussen und umgekehrt. Eine Krankheit der Seele wäre demnach oft auch eine Krankheit des Körpers oder zumindest eng mit ihr verbunden.
Trotzdem geht auch Aristoteles bei psychischen Störungen als Folge von Ungleichgewichten aus – sei es in den Körpersäften, den Affekten oder im Lebenswandel. Seine Empfehlungen sind daher präventiv und auf die Förderung eines ausgewogenen, tugendhaften und vernunftgeleiteten Lebens ausgerichtet.
Epiktet
Epiktet mahnte, zwischen dem, was in unserer Kontrolle liegt (Gedanken, Einstellungen), und dem, was nicht in unserer Kontrolle liegt (körperlicher Schmerz, äußere Ereignisse), zu unterscheiden. Er befürwortete die Umdeutung negativer Erfahrungen als Gelegenheiten für Wachstum.
» Epiktet: Handbüchlein der Lebenskunst (#Affiliate-Link/Anzeige)
Was empfiehlt Epiktet gegen psychische Probleme?
Epiktet würde Menschen mit depressiven Tendenzen die Kognitive Verhaltenstherapie (#Affiliate-Link/Anzeige) empfehlen. Laut ihm hilft es, die Denkweise zu ändern, Urteile zu überprüfen, sich auf das zu konzentrieren, was in der eigenen Macht steht, und das Unveränderliche mit Gelassenheit zu akzeptieren.
Marc Aurel
Der Philosophenkaiser Marc Aurel hob die Kontrolle der eigenen Wahrnehmung und Reaktion auf Schmerz hervor. Er stellt fest, dass „Schaden nur in der Fähigkeit besteht, ihn zu sehen“, und dass durch das Aufheben dieser Einschätzung der Schmerz verschwindet. Er glaubt, dass, wenn der Geist richtig funktioniert, keine Tränen nötig sind; die Kontrolle der Reaktion lässt den Schmerz als unwirklich erscheinen.
» Marc Aurel: Selbstbetrachtungen (#Affiliate-Link/Anzeige)
Welchen Heilungsweg schlägt Marc Aurel vor?
Wie Epiktet bot auch Marc Aurel keine "Heilung" im medizinischen Sinne an, sondern eine Lebensphilosophie und mentale Praktiken, um innere Ruhe und Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Seine Ratschläge sind sehr praxisorientiert und auf die Bewältigung des täglichen Lebens ausgerichtet: Perspektive verändern, Unvermeidliches akzeptieren, tugendhaft handeln, in Selbstbeherrschung üben.
Seneca
Betonte ganz in der Manier der Stoa, dass „alles vom Denken abhängt“, wenn es um den Umgang mit Schmerz geht. Er rät, die Gedanken auf andere Dinge zu lenken, die Freude bereiten oder die man gut kann. Tröstende Gedanken tragen zur Genesung einer Person bei und wirken sich auch physisch positiv aus. Er schlägt vor, Freude daran zu finden, etwas Unangenehmes ertragen zu haben.
So liefert der alte Stoiker in De Ira (#Affiliate-Link/Anzeige) eine philosophische und psychologische Analyse des Zorns, seiner Ursachen und zerstörerischen Wirkungen und wie man ihn überwinden kann, um innere Ruhe zu bewahren. Er betrachtet Zorn als eine Art zeitweiligen Wahnsinn.
In De Tranquillitate Animi (#Affiliate-Link/Anzeige) bietet er praktische Ratschläge zur Bewältigung von Unruhe, Ängsten, Langeweile und zur Erlangung inneren Friedens durch die richtige Einstellung zum Leben und zum Schicksal. Sehr aufschlussreich sind Senecas » Briefe an Lucilius (#Affiliate-Link/Anzeige), die Epistulae morales ad Lucilium: sie behandeln den Umgang mit Furcht (vor dem Tod), Trauer, Schmerz und den Herausforderungen des menschlichen Lebens, stets mit dem Ziel der inneren Unerschütterlichkeit.
Was rät Seneca bei psychischen Problemen?
Seneca war ebenfalls Stoiker und überzeugt, dass nicht die Dinge selbst uns beunruhigen, sondern unsere Meinungen über die Dinge. Unsere inneren Urteile über Ereignisse sind die eigentliche Quelle unseres Leidens. Also: Schicksal annehmen, Selbstgenügsamkeit, Rastlosigkeit vermeiden, stetige Reflexion und Selbstprüfung, soziale Verantwortung übernehmen usw.
Seneca »Wie man Schweres leichter trägt« (#Affiliate-Link/Anzeige), Seneca für Gestresste
Wie aussagekräftig sind antike Quellen über psychische Probleme?
Bei antiken Quellen über "Depressionen und Co." haben wir es nicht mit einer wissenschaftlichen oder medizinischen Beschreibung im heutigen Sinne zu tun. Es handelt sich um:
philosophisch-moralische Reflexionen über menschliches Leid und die Wege zur inneren Harmonie.
Erklärungsmodelle, die auf der Humorallehre basierten und fundamental anders waren als unsere modernen Medizin-Konzepte.
kulturelle und historisch spezifische Interpretationen.
Das gilt auch für die nachfolgenden Jahrhunderte.
Philosophie des Mittelalters über Depressionen
Augustinus, Thomas von Aquin, Robert Burton
Über die Trägheit der Seele als Sünde
Augustinus von Hippo (354–430 n. Chr.)
Augustinus’ Autobiografie ist eine der tiefgründigsten psychologischen Selbstreflexionen der Geschichte. In seinen berühmten Confessiones / Bekenntnisse (#Affiliate-Link/Anzeige) beschreibt er seine eigenen inneren Kämpfe, seine Sünde (insbesondere der sexuellen Begierden), seine Reue und die Qual der Entscheidung. Er ringt mit innerer Zerrissenheit, Trauer und einem Gefühl der Leere, bis er durch den Glauben inneren Frieden findet. Der Kirchenvater schrieb sehr anschaulich die psychische Last der Schuld und des Verlangens.
Thomas von Aquin (1225–1274)
Auch Thomas legte eine systematische Analyse der menschlichen Leidenschaften (Emotionen) und ihrer Rolle im menschlichen Leben vor. In seiner Schrift "Summa Theologiae" (#Affiliate-Link/Anzeige) finden sich umfassende Klassifizierungen und Analysen der Leidenschaften der Seele (z.B. Liebe, Hass, Begehren, Abscheu, Freude, Trauer, Hoffnung, Furcht, Verzweiflung, Zorn). Augustinus hatte ganz sicher keine medizinische Definition im Sinn, er schildert psychische Zustände und ihre moralische Bewertung. Die "Desperatio" (Verzweiflung/Hoffnungslosigkeit) wird als eine Sünde gegen die Hoffnung betrachtet.
Robert Burton (1577–1640)
Burton war streng genommen kein Philosoph, sondern ein Gelehrter. Trotzdem gilt sein Werk als eines der umfassendsten zur Melancholie und ist philosophisch, medizinisch und psychologisch hoch bedeutsam. Es verknüpft antike Traditionen mit zeitgenössischem Wissen der Neuzeit / Renaissance.
In “Die Anatomie der Melancholie” (#Affiliate-Link/Anzeige) von 1621 katalogisiert, analysiert und diskutiert er speziell die Melancholie (als Depression) in all ihren Formen und Ursachen: von physiologischen (Humoralpathologie) über psychologische (Liebeskummer, Angst, Verzweiflung, Einsamkeit) bis hin zu sozialen und religiösen Aspekten. Der alte Burton zitiert Hunderte antiker und mittelalterlicher Quellen und bietet eine Enzyklopädie des Verständnisses von Depression (vor der modernen Psychiatrie).
Baruch Spinoza (1632–1677)
Spinoza verstand die menschlichen Affekte "geometrisch", d. h. er untersuchte Gefühle auf die gleiche systematische, rationale und unvoreingenommene Weise, wie man mathematische oder geometrische Objekte untersucht. Alles erfolgt notwendig aus bestimmten Ursachen.
In seiner "Ethik" (#Affiliate-Link/Anzeige) von 1677 (insbesondere die Teile III und V) analysiert er die Dynamik von Freude, Trauer und Begehren und wie sie durch äußere Ursachen oder mangelnde Erkenntnis zu "Passions" (passiven Affekten, die uns leiden lassen) werden. Er schreibt von einer "Knechtschaft des Menschen" durch Affekte.
Die wahre Freiheit und der "Geistesfrieden" entstehen durch die intellektuelle Erkenntnis der Notwendigkeit aller Dinge und der Ursachen unserer Affekte. Wesentlicher näher an unserer modernen Philosophie war Spinozas Verständnis der Einheit von Körper und Geist: Die Affekte waren für ihn gleichzeitig körperliche Zustände und mentale Ideen.
Philosophie der Neuzeit über Depressionen
Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre
Die Wiederbelebung des melancholischen Genies
Immanuel Kant (1724–1804)
Melancholie als Temperament
In der Aufklärung wurde Melancholie oft mit Hysterie und einem schwachen Nervensystem assoziiert. Kant (1724–1804) bildete hier eine Ausnahme, denn für ihn war der Melancholiker offener für das Erhabene.
Melancholie und das Erhabene
In § 50 seiner » Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (#Affiliate-Link/Anzeige) stellte Kant fest, dass Melancholie (Tiefsinnigkeit, melancholia) „an sich noch keine Geistesverwirrung ist, aber sehr wohl dazu führen kann“. Sie könne eine „bloße Einbildung des Elends“ sein oder auf eine „tiefdenkende Person“ hinweisen.
In den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen verband Kant das melancholische Temperament mit einem vorherrschenden Gefühl für das Erhabene. Er schrieb sogar, dass eine Person mit einer melancholischen Gemütsverfassung die „tugendhafteste“ sei, weil deren Gedanken, Worte und Taten auf Prinzipien basieren.
Die Gefahr der Melancholie
Melancholie, wenn sie mit Neugierde verbunden ist, kann zu einem Element des Erkenntnisprozesses werden, ähnlich der Verlegenheit, die man angesichts der Welt empfindet, wenn man von ihr erstaunt ist. Wenn sie jedoch ein in Langeweile verhafteter Zustand ist, kann sie zu Selbsthass, Wahnsinn und Suizid führen. Kant stellte die einfache Gleichsetzung von Geisteszuständen mit „Gesundheit“ oder „Krankheit“ infrage und öffnet die Tür für spätere existenzialistische Ansichten, wonach Leiden ein Weg zur Authentizität sei.
Søren Kierkegaard (1813–1855)
Existenz & Not des Menschen
Kierkegaard ist bekannt für seine tiefgreifende Auseinandersetzung mit Zuständen, die heute unter den Oberbegriff “psychische Probleme” fallen würden, aber von ihm existenziell, ethisch und religiös interpretiert wurden.
In „Entweder – Oder“ (#Affiliate-Link/Anzeige) beleuchtet er die psychische Leere und Verzweiflung eines rein ästhetischen, genussorientierten Lebens („Ästhetiker“), im Gegensatz zum ethischen Leben der Verbindlichkeit. Die innere Zerbrochenheit des Ästhetikers wird als psychische Not dargestellt.
Leiden und Melancholie
Sein Werk „Furcht und Zittern“ (#Affiliate-Link/Anzeige) thematisiert die existenzielle Angst, die aus dem religiösen Glauben und der „teleologischen Suspension des Ethischen“ (z. B. Abrahams Opfer) resultiert. Diese Angst ist eine grundlegende Unsicherheit angesichts von Freiheit und göttlicher Unendlichkeit.
Aufschlussreich ist auch „Die Wiederholung“ (1843): Darin behandelt er das Leiden an der Vergangenheit, Melancholie und existenzielle Stagnation, die aus dem Scheitern der Wiederholung (der Sehnsucht nach Rückkehr des Vergangenen) entstehen können.
Angst und Verzweiflung
Sein Hauptwerk zum Thema Angst ist „Der Begriff Angst“ (#Affiliate-Link/Anzeige). Er definiert Angst als eine grundlegende menschliche Bedingung, einen „Schwindel der Freiheit“, der aus der Möglichkeit der Wahl und der Sünde entsteht.
In „Krankheit zum Tode“ (#Affiliate-Link/Anzeige) von 1849 geht Kierkegaard speziell auf die Verzweiflung ein, die er als „Krankheit zum Tode“ benennt – einen Zustand des existenziellen oder geistigen Todes. Er kategorisiert verschiedene Formen der Verzweiflung (sich selbst nicht sein wollen, man selbst sein wollen ohne Gottesbezug, Akzeptanz von Endlichkeit/Unendlichkeit nicht möglich), die Parallelen zu Depressionen und Identitätskrisen aufweisen.
Kontext bei Interpretation beachten
Wie immer wichtig: den Kontext bei der Interpretation von Kierkegaards Schriften beachten. Auch er war kein Psychiater und verwendete die Begriffe „Angst“ und „Verzweiflung“ nicht im Sinne von psychiatrischen Diagnosen. Dennoch bieten seine phänomenologischen Beschreibungen der inneren Welt des Menschen, seiner Qualen, seiner Widersprüche eine reiche Quelle für ein besseres Verständnis seelischer Leiden.
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)
Melancholie als Charakter
Melancholie ist für Schopenhauer keine Krankheit, sondern entspricht einem Charaktertypus. Von diesem hängt die individuelle Perspektive auf Welt und Mensch ab: „Daher affizieren dieselben äußeren Vorgänge, oder Verhältnisse, Jeden ganz anders, und bei gleicher Umgebung lebt doch Jeder in einer andern Welt.“
Der Kreislauf von Wollen und Leiden
In „Die Welt als Wille und Vorstellung“ (#Affiliate-Link/Anzeige) legt er das menschliche Leben als einen Kreislauf aus unstillbarem Wollen und daraus resultierendem Leiden dar, das nur kurz von Befriedigung und dann von Langeweile unterbrochen wird. Die Angst vor dem Tod und die existenzielle Leere sind zentrale psychische Konsequenzen dieses Strebens. Erlösung vom Leid findet er temporär in ästhetischer Kontemplation und radikaler in der Verneinung des Willens (Asketismus).
Seine Schrift „Über den Willen in der Natur“ (#Affiliate-Link/Anzeige) untermauert dagegen die Allgegenwart dieses blinden Willens auch in unbewussten Trieben und Instinkten des Menschen – das sind Ansätze, die bereits als moderne psychologische Konzepte des Unbewussten gelten können.
Erlösung durch ästhetische Kontemplation
Seine „Parerga und Paralipomena“ (#Affiliate-Link/Anzeige), insbesondere die beliebten „Aphorismen zur Lebensweisheit“ (#Affiliate-Link/Anzeige), bieten praktische psychologische Ratschläge zur Bewältigung von Unglück, dem Umgang mit dem Leiden der Welt und der Suche nach innerer Zufriedenheit.
Er reflektiert über die psychologischen Fallstricke äußerer Güter und die Notwendigkeit der Selbstkenntnis. Auch Themen wie Traum, Wahnsinn und die psychologische Wirkung von Kunst werden hier beleuchtet. Schopenhauer liefert somit eine umfassende, pessimistische, aber tief psychologische Analyse der menschlichen Existenz und ihrer Leiden. » vgl. depressiver Realismus
Friedrich Nietzsche (1844–1900)
Leid als Bedingung für persönliche Größe
Nietzsche (1844–1900) betrachtete Leid als einen entscheidenden Aspekt menschlicher Entfaltung und als wesentlich für die menschliche Entwicklung. Sicher hat er auch aus diesem Grund so reichhaltiges Material hinterlassen. Er argumentierte, dass der Mensch nur durch Kampf und Widrigkeiten seine eigenen Grenzen überwindet und sein volles Potenzial erreicht.
Macht und Sinn im Leid
In seinem postum veröffentlichten Werk „Wille zur Macht“ (#Affiliate-Link/Anzeige) analysiert er, dass der grundlegende menschliche Impuls nicht darin besteht, Leid zu vermeiden, sondern „nichts Geringeres als Leid selbst zu wollen“.
Sinn im Leid zu finden, ist gleichbedeutend mit der Bejahung des Lebens selbst. Es repräsentiert Selbstbeherrschung und eine Wertschätzung des Lebens mit all seinen „Überwindungen“. Darin behandelt er auch ausführlich den Nihilismus als psychischen Zustand und zeigt Wege zu seiner Überwindung. Und in Jenseits von Gut und Böse (#Affiliate-Link/Anzeige) diskutiert er das tiefe Leid als etwas Veredelndes und Trennendes, das zu tieferer Erkenntnis führt.
Absolute Ergebenheit ins Leiden
Nietzsche ist radikal und anklagend. So auch in „Menschliches, Allzumenschliches“ (#Affiliate-Link/Anzeige) von 1878 nimmt er die Motivationen, Illusionen und die psychologischen Grundlagen der Moral auseinander, – fast alles möchte er als Ressentiments und Ängste entlarven.
„Die fröhliche Wissenschaft“ (#Affiliate-Link/Anzeige) von 1882 erforscht die psychologischen Folgen des „Gott ist tot“-Satzes (existenzielle Leere, Nihilismus) und bietet Gegenkonzepte wie Amor Fati (Liebe zum Schicksal) und die ewige Wiederkunft als radikale psychologische Tests zur Bejahung des Lebens bzw. Leidens.
Auch kritisiert er in „Jenseits von Gut und Böse“ (#Affiliate-Link/Anzeige) von 1886 philosophische Konzepte und untersucht die psychologischen Strukturen verschiedener „Typen“, oft unter Verwendung von Begriffen wie „Neurose“ und „Krankheit“.
Leid als notwendige Quelle für Einsicht
Sein wichtigstes Werk (im Kontext von psychischer Krankheit) ist allerdings „Ecce Homo” (#Affiliate-Link/Anzeige) von 1908. Im Grunde eine autobiografische Selbstreflexion Nietzsches: hier interpretiert er seine körperlichen und mentalen Leiden als Quelle philosophischer Einsichten. Hier findet sich Nietzsches Selbstinterpretation, die den ultimativen Wert alles Geschehenen, einschließlich seines Leidens, als Beispiel seines Amor fati proklamiert.
Er bestand darauf, sein Leid nicht als edel anzusehen, sondern als Ergebnis harter Forschung. Bedeutet: Die Überwindung von Qualen führt zu größeren Errungenschaften als Erkenntnisse in „normalen“, leidfreien Zuständen.
Im Gegensatz zu vielen anderen wertet Nietzsche also das Leiden auf – als notwendigen und wünschenswerten Katalysator für Wachstum, Kreativität und die Entwicklung des Charakters. Er unterschied zwischen „gesundem“ Leiden (das zur Überwindung führt) und „ungesundem“ Leiden (das aus Schwäche und Ressentiment geboren ist).
Im Hinterkopf ist zu behalten: Obwohl er Begriffe wie "Krankheit" oder "Dekadenz" verwendet, setzt er sie oft metaphorisch ein, um kulturelle und moralische Werte zu kritisieren, die er als lebensverneinend oder schwächend ansah. » vgl. Macht die Gesellschaft depressiv?
Fazit: Macht zu viel Philosophieren depressiv?
Das Nachdenken über die großen Fragen des Lebens ist eine zweischneidige Angelegenheit.
Während Philosophie oft als Weg zur Selbstreflexion und Erkenntnis gepriesen wird, zeigen die Lebensgeschichten einiger Denker, dass tiefgründiges Philosophieren auch mit Schwermut verbunden sein kann.
Philosophen wie Kant, Schopenhauer und Nietzsche fordern uns auf, über das individuelle Leiden hinauszugehen, indem sie es als integralen Bestandteil des menschlichen Daseins ansehen.
Da ist was dran. – Doch die Frage bleibt: Heizt das philosophische Grübeln wirklich die Depression an bzw. sind Philosophen anfälliger für Depressionen? Oder verarbeiteten sie “nur” ihre Depressionen in ihren Überlegungen?
Kommt ganz darauf an. In der Regel sind Leiden oft der Anlass, sich mit tiefsinnigeren Gedanken auseinanderzusetzen. Philosophie kann hier sowohl eine Quelle der Einsicht als auch Anlass zur Schwermut sein. Je nach Individuum und persönlichem Kontext.
So waren zwar einige der bekanntesten Philosophen depressiv (oder kämpften mit anderen Arten von psychischen Problemen), doch es gab über die Jahrhunderte hinweg mindestens genau so viele historische Persönlichkeiten, Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle, die nicht psychisch erkrankt waren und Großes leisteten. Vgl. Genie & Wahnsinn – Schriftsteller mit Depression
Krankheit ist keine Bedingung für Genialität.
Um wieder einmal mit Frankl zu schließen: “So sehr es aber auch richtig sein mag, dass Pathologie an sich noch lange nicht gegen ein Werk spricht, sowenig spricht Pathologie als solche zugunsten des Werkes.(…) Krankheit selbst ist niemals schöpferisch.”